

über Menschen und Tiere werde ich
Euch erzählen, die mir als
Persönlichkeiten begegnet sind...
Genunea Musculus
Episode aus dem Roman „Genunea. Czernowitz liegt nicht nur in der Bukowina“ Heimkehr nach Czernowitz |








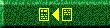
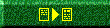
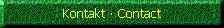
Der Zug voller Soldaten führte die Jugend in den Krieg, Nuni in ihre alte Heimat. Niemand wusste, was ihn erwartete... und die Räder rollten und knarrten, so oft man sich diese Frage stellte.
Trotzdem fehlte es nicht an Enthusiasmus. Die Jungen sangen Kriegslieder, erzählten Heldenwitze und ergötzten sich an köstlichen Dingen aus ihren Provianttaschen. Man bot Nuni kleine viereckige, gefüllte Oblaten an. „So etwas habe ich noch nie gegessen. Was ist das?“, fragte sie ihre Reisebegleiter. „Konzentrierte Vitamine. die ausgezeichnet schmecken und uns neue Kräfte geben, um den Feind leichter zu besiegen.“ Nuni lachte und verschlang von jedem je ein Stück.
Ihr gegenüber saß ein Junge, der sich von den anderen unterschied. Sein ernstes Gesicht, das Melancholie ausdrückte, fiel ihr auf. Er erzählte ihr, dass er, Musikstudent in Leipzig, schon einen Bruder im Krieg verloren hatte und dass er gern Dirigent und Komponist werden würde, sofern er den Krieg überlebt. „Sie schaffen es schon, es ist ein wunderbarer Beruf“, ermutigte ihn Nuni.
„Ich wünsche es mir aus ganzem Herzen. Ein kleiner Talisman, den mir meine Mutter zum Abschied gab, bringt mir hoffentlich Glück.“ Er nahm seine Brieftasche, um ihn Nuni zu zeigen. Er fehlte. Der Unglückliche konnte seine Nervosität nicht verbergen. Seine schmalen, zittrigen Hände begannen, in allen Taschen der Uniform zu suchen. Auch seinen Koffer durchstöberte er. Erfolglos. Die „Kameraden“ verspotteten ihn, ohne Mitleid, ohne Mitgefühl.
Blass und erschöpft sank er auf die Holzbank zurück und starrte aus dem Fenster, den fliegenden weißen Wolken nach. Tief beeindruckt, spürte Nuni, dass sie ihm helfen müsse. „Es ist heiß hier“, meinte sie, „würden Sie bitte so nett sein und mir im Gang das Fenster öffnen?“ Er folgte ihr hinaus und tat, wie gebeten. Nuni bedankte sich, nahm seine Hand und schob ihren Ring auf seinen kleinen Finger. „Ich habe ihn von meiner Oma, die mich sehr lieb hatte. Nun wird er Ihnen Glück bringen und Sie vor allem Bösen beschützen.“
Die Wolken zogen schneller, rissen auf, und ein Fleck blauen Himmels erhellte sein trauriges Gesicht. „Und Sie, Sie bleiben jetzt ohne dieses schöne Andenken an Ihre Oma?“
„Ach, mir bleiben die Erinnerungen an sie, an ihre Liebe, an ihre Zärtlichkeit; auch habe ich viele Gedichte von ihr, die für mich viel wertvoller sind als der Ring.“ Beide kehrten ins Abteil zurück. Es wurde stiller, und Nuni spürte, dass auch hier - auch hier - das Denken anfing.
In Polen (Wartheland) stiegen alle Soldaten aus, um mit einem anderen Zug weiter nach Russland zu fahren.
Nuni schlief ein und erwachte gegen acht Uhr abends an einer Grenze. Die Lokomotive puffte noch, als vor ihr schon ein junger deutscher Grenzoffizier stand und ihren Pass verlangte. Verwundert nahm er den Passierschein an sich und forderte Nuni auf, auszusteigen. „Sind wir an der rumänischen Grenze oder an der deutschen?“, fragte sie ihn, noch verschlafen. „Meine Dame, wir befinden uns an der deutschen Grenze.“
„Ich möchte aber zur rumänischen, ich muss meine Eltern in Czernowitz besuchen. Bitte lassen Sie mich weiterfahren.“
„Leider wird das nicht möglich sein. Sie müssen über Nacht hierbleiben, dafür bitte ich um Ihr Verständnis. Morgen werde ich mich genau über Ihre Eltern informieren, und wenn alles klappt, dürfen Sie sie besuchen. Wir befinden uns im Krieg, und es gibt viele Spione... man kann nicht vorsichtig genug sein.“
Schon griff er Nunis Koffer, gab ihr seinen Arm und half ihr aus dem Abteil. Sie war die einzige Reisende, die aussteigen musste. Der fast leere Zug fuhr weiter.
Der Bahnhof, nur eine strohgedeckte Holzbaracke, diente als Wartesaal, Schalter, Zollabfertigung und Bahnhofsvorsteherbüro. Nuni unterwarf sich der Staatsgewalt und trat schüchtern hinein. Neben einem Tisch und einer Holzbank erblickte sie auch ein Bett - das ihr so vertraute graue Eisenbett mit einer noch graueren Decke - für sie das graue, grauenhafte Kennzeichen des „Dritten Reiches“. „Also, hier werde ich schlafen.“
„Aber nein“, unterbrach sie gleich der stattliche Offizier, „das kann ich Ihnen doch nicht zumuten. Sie werden selbstverständlich bei mir übernachten, es ist doch etwas komfortabler.“ „Danke“, erwiderte Nuni, „ich vermisse den Komfort nicht im geringsten. Hier gefällt es mir und hier bleibe ich.“
Die graugrün uniformierte Gestalt verbeugte sich erst, dann erhob sie sich wie ein Truthahn in Kampfposition und stellte sich vor: „Gestatten, Leutnant Eickert. Meine Dame, Sie befinden sich unter deutschem Schutz, ich bin für Sie verantwortlich und Sie dürfen über Nacht nicht allein bleiben.“
„Wo wohnen Sie, und mit wem?“, entgegnete Nuni befangen. „Zweihundert Meter von diesem sogenannten Bahnhof entfernt habe ich ein kleines Häuschen mit einem großen Garten ganz für mich allein.“
„Das ist mir viel zu gefährlich; oft hörte ich von Partisanenüberfällen auf deutsche Offiziere, und in diesem polnisch-ukrainischen Nest gibt es sicher viele davon. Ich bleibe lieber hier, wenn auch alleine, ich habe keine Angst.“
Auch dieses Argument überzeugte den jungen Leutnant nicht und es wurde ihm auch nicht klar, dass Nuni eben vor ihm Angst hatte. „Meine Pistole und dieses Bajonett“ - beide zog er jetzt aus seiner Hosentasche, „werden uns vor allem schützen.“
Er nahm Nuni an der Hand, und beide gingen der Dunkelheit entgegen. Mit einer Taschenlampe wies er ihr den katzenkopfgepflasterten Weg, und bald erreichten sie das Haus, weit entfernt vom Dorf. Eine verrostete, feuchte Türklinke, eine modrige, knirschende Holztür hießen sie in die kleine Veranda eintreten. Leutnant Eickert verließ Nuni für einen Augenblick.
Mit einer Petroleumlampe kehrte er zurück, um auch den Rest der Gemächer zu beleuchten und Nuni ihr Nachtasyl vorzustellen. In der Rauchwolke der flammenden Lampe erblickte sie ein kleines Zimmer mit zwei Betten und vielen bunten, handgewebten Wandbehängen und Teppichen.
„Das ist Ihre Schlafstätte - nicht die allergünstigste, aber doch besser als die in der kleinen Bahnhofsbude, und ich werde Sie aus meinem anderen Zimmer nebenan behüten.“
Ein Stein fiel Nuni vom Herzen; sie musste das Zimmer nicht mit Leutnant Eickert teilen. Er brachte ihr eine Waschschüssel, eine Wasserkanne, einen Petroleumkocher zum Wasserwärmen, und neben die Tür stellte er diskret einen Eimer für eventuelle menschliche Entleerungsbedürfnisse. „Ja, mit den Toiletten ist es hier auf dem Land etwas kompliziert; natürlich gibt es eine hinter dem Haus. Wenn Sie sie aufsuchen wollen, lasse ich Ihnen meine Taschenlampe hier.“ „Danke für Ihre freundliche Sorge.“ Nuni nahm seine Lampe.
Das bewusste Örtchen erreichte sie aber nicht; der Weg durch ein Maisfeld war ihr zu lang, und so hockte sie sich im Dunkeln zwischen die Maiskolben, sprang aber schreiend vor Schmerz sogleich wieder auf. Ein spitzer Fremdkörper stak in ihrem Po. Leutnant Eickert eilte sofort zu Hilfe - mit Bajonett und Pistole. „Kein Partisan. Ich glaube, mich hat eine Distel gestochen, es tut sehr weh“, murmelte Nuni verschrocken. Sie betastete den „Tatort“ und stellte mit Entsetzen fest, dass das „Corpus delicti“ tief in ihrer Pobacke saß.
„Er muss entfernt werden. Schaffen Sie das allein?“, erkundigte sich der Leutnant. „Meine Nägel sind zu kurz. Würden Sie es versuchen, vielleicht mit einer Pincette?“, bat ihn Nuni. „Leider besitze ich keine, aber heraus werden wir ihn schon kriegen!“, antwortete er stolz. Nunica verlor in diesem Augenblick jede Scham, ihre Ängste gingen soweit, dass sie sich schon mit Blutvergiftung, Lungenembolie und Herzinfarkt sah. Der Leutnant bereitete zwei Petroleumlampen, eine Nagelschere statt Pincette, Franzbranntwein und ein Pflaster vor.
Nuni stellte ihm ihre verletzte Intimsphäre auf dem improvisierten Operationstisch zur Schau. Geschickt und fast schmerzlos entfernte der gute Leutnant den Stachel, erwärmte dann noch schnell das Wasser zum Zähneputzen und schenkte Nuni eine besonders gute Schweinsborsten-Zahnbürste mit Etui. Gegen elf Uhr am nächsten Tag werde er sie mit einem sanften Klopfen ans Fenster wecken, versprach er ihr. Der Zug nach Czernowitz sollte dann mittags um 12.30 Uhr abfahren.
Einer guten Nachtruhe stand nun nichts mehr im Wege - außer psychoanalytischen Befürchtungen, die Nunis Phantasie zermürbten: sie allein mit dem Leutnant, und weit und breit keine deutsche, rumänische oder Partisanen-Seele? Ab und zu hörte man von Weitem Hundegebell aus dem Dorf, und die kleinen Kerzen in den Häusern erloschen auch allmählich.
Ob ihr die vielen Vitaminschnitten, die sie während der Fahrt verschlungen hatte, die Kraft verleihen würden, eventuelle deutsch-erotische Grenzversuche abzuwehren? Sie verlangte vom Leutnant den Zimmerschlüssel, um sich, wie sie meinte, vor den Partisanen zu schützen. Der lachte hell auf und wies auf die wacklige, morsche Tür, die wohl noch nie einen Schlüssel gesehen hatte; dann verabschiedete er sich förmlich, verließ Nuni und ihr Zimmer.
Die Nacht wurde zur Hölle. Der Leutnant schlief fest und hatte nicht die geringste Absicht, seinen Adonis-Charme und seine Liebeskunst Nuni zu erweisen. Aber sie wurde von vielen anderen Lebewesen aufgesucht und vernascht. So musste sie die ganze Nacht die Betten wechseln, um den Tierchen - genannt Wanzen - zu entfliehen. Erst am Morgen schlief sie ein und erwachte plangemäß durch das sanfte Fensterklopfen.
Schnell machte sie sich zurecht und lief zum Bahnhof. Leutnant Eickert begrüßte sie strahlend: „Es hat alles geklappt. Ihre ehrenvollen Eltern erwarten Sie mit Freude. Der Zug fährt in fünfzehn Minuten ab.“
„Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken; wieviel bin ich Ihnen schuldig?“
„Natürlich gar nichts“, erwiderte der Leutnant, „es war doch meine Pflicht - und außerdem auch mein Vergnügen, Sie kennengelernt zu haben.“
Auf dem Tisch stand eine Blechdose mit der Aufschrift „WHW“ („Winterhilfswerk“), in die Nuni fünf Mark hineinwerfen wollte. „Es ist doch viel zu viel, eine Mark genügt vollkommen“, meinte der Leutnant. „Nur eine Mark für eine Übernachtung und einen perfekten chirurgischen Eingriff scheint mir doch wenig.“ Dann gab sie ihm die Hand und stieg fröhlich in den Zug. Hier konnte sie sich endlich auf das Wiedersehen mit ihrer Familie nach dreijähriger Abwesenheit freuen. In Gedanken versunken, schaute sie aus dem Fenster.
Der Zug wurde langsamer. Nuni stand auf und bemerkte, dass sie über eine Brücke rollten. In krampfhafter Haltung starrte sie ein kleiner rumänischer Soldat in Khaki-Uniform an. Seine bis zu den Knien geschnürten Opanken und sein Mordinstrument, ein Gewehr mit verrostetem Bajonett, das er krampfhaft an seine rechte Schulter presste, löste bei Nunica Mitleid aus. Der kleine rumänische Bauer - er hatte sicher seinen Hof, seine Berge, seine Schäflein, seine Panflöte verlassen, seine farbenfrohe Folkloretracht abgelegt - steht nun hier an der Brücke Wache. Seine lebhaften, schwarzen Augen aber konnten Herzenswärme, Gastfreundschaft und Frohsinn nicht verbergen.
Endlich hielt der Zug auf rumänischem Boden, in dem Grenzdörfchen Gregore Ghica Voda. „Doamna Dimitrovici, Doamna Dimitrovici, Frau Niefer, Frau Dimi... Niefer!“, erklang der Ruf einer Männerstimme, die sich längs des eingefahrenen Zuges zum Echo wiederholte. Es war die Stimme eines rumänischen Grenzoffiziers, der sich wie ein Komet auf Nuni stürzte, als sie, auch hier als einzige Reisende, aus dem Zug stieg. „Ihre Eltern, Ihre Eltern... sind Sie Frau Niefer, Sie verstehen, die Tochter des Generaldirektors Doktor Dimitrovici? Ihre Eltern baten mich, Ihnen auszurichten, dass sie erst abends hier sein können.“
„Erst abends? Warum so spät?“, fragte Nunica ihn erstaunt. „Kommen Sie mit. Sie müssen essen, viel essen. Das ist der einzige Wunsch Ihrer Eltern.“
Nuni begab sich in seine Obhut, und beide gingen ins Bahnhofsrestaurant. Dort standen nicht mehr als drei, vier Tische. Die Theke hingegen bot Schinkenbrötchen, Käse, Kaviar, Heringe, panierte Schnitzel, Oliven, Tomaten, Cremeschnitten, verschiedene Torten, Kekse, Obst und Getränke. Nuni betrachtete die Auslage andachtsvoller als einst ihre Ikonen der Heiligen Jungfrau. Das vollgespickte Buffet bot ihr langersehntes Brot an. Nuni fragte bescheiden, ob man all die Delikatessen kaufen kann - markenfrei kaufen kann. Sie wurde von mehreren rumänischen Offizieren, die an den Tischen gesessen hatten, umzingelt. Jeder von ihnen hielt etwas von diesen Köstlichkeiten lachend in den Händen.
„Alles dürfen Sie markenfrei verzehren! Bis zum Abend reicht Ihnen die Zeit dafür voll aus!“ Die drei Tische wurden zusammengeschoben, und ein Kellner brachte auf einem riesigen Tablett das raffinierte kulinarische Angebot. Auch die Konversation in Rumänisch machte Nuni Spaß, und wie üblich begannen die Witze, nachdem sich jeder der Offiziere bei ihr vorgestellt hatte. Mit vollem Munde eilte Nunica zum Telefon, als man ihr das Gespräch mit Czernowitz ankündigte. „Willkommen, meine Nuni. Bist Du etwa schwanger?“, ertönte zitternd Lillys Stimme.
„Ganz im Gegenteil!“, rief Nuni energisch, „Ich denke gar nicht daran! Aber warum seid Ihr nicht hier?“
„Gottseidank“, erwiderte Lilly, „ich vermutete schon in meinen Ängsten, Du bist hierher gekommen, damit wir Dir in diesen schweren Stunden beistehen“, sagte Lilly erleichtert, „wir haben schon die ganze Zeit mit Bukarest telefoniert, um vom Innenministerium eine Einreisegenehmigung für Dich zu erhalten, damit Du doch ein paar Tage zuhause verbringen kannst. Wenn alles klappt, holen wir Dich am Abend ab. Bis dahin iss bitte alles, was Du siehst, Du armes Kind.“ Und Nuni aß und aß, bis sie von einem der Offiziere unterbrochen wurde.
„Meine Dame, Sie staunen so über das Essen und haben einen solch guten Appetit. Gibt es denn in Deutschland keine Lebensmittel?“
„Nicht gerade alles“, antwortete Nuni, „dort besitzen sie Panzer, Kartoffeln, Flugzeuge, Kraut, Zahn- und Stiefelbürsten, Autobahnen, den Führer, Lebensmittelkarten, Sondermeldungen, aber keinen Schinken, keine Schokolade und keinen rumänischen Humor.“
Dann aß sie weiter und beobachtete die ungewöhnliche Bahnhofsatmosphäre. Es war ein stiller Bahnhof. Außer dem einzigen Personenzug, der, kaum besetzt, nur einmal täglich verkehrte, rasten nur selten einmal Güterzüge vorbei. Die Landstraße aber bot einen anderen Eindruck. Viele vollbeladene, von Ochsen gezogene Heukarren wirbelten den Staub der ungepflasterten Straße in weißen Wolken auf. Durch die offnen Fenster der gemütlichen Bahnhofsstube ließen sie sich wie feiner Puderzucker auf Cremetorten und belegten Brötchen nieder. Das kulturelle Leben hingegen spross aus allen Fugen.
Abends versammelten sich hier die Persönlichkeiten der Umgebung. Der orthodoxe Pfarrer kam mit seinen zum Segensgruß ausgestreckten Händen; den deutschen „Endsieg“ überließ er Gottes Fügung und prostete Nunica ergebenst eine „Zuica“ nach der anderen zu. Der Dorflehrer war mit erhobenen Finger erschienen und feierte begeistert die allerletzte „Sondermeldung“ mit; anschließend bestellte er beim Kellner eine blaugesottene Forelle, die aber zu dessen Bedauern an diesem Tage gerade fehlte.
Der Polizist mit seiner kleinen Lederpeitsche schließlich kündigte einige Unruhen der Partisanen an der Grenze an; er werde aber sofort für Ordnung sorgen - und der Knoblauchgeruch aus seinem Mund erinnerte Nuni immer wieder daran, dass sie sich auf dem Boden ihrer alten Heimat befand. Auch ein Bauer hatte sich demütig in die Bahnhofskneipe geschlichen und klagte über die Dürre und über die schlechte Ernte, kippte einen kleinen „Korn“, zahlte und ging, vielleicht, um weiter auf seinem Feld zu arbeiten. Emsig bewirtete der Kellner seine Gäste, lauschte ihren Gesprächen und überlegte sich, wem er wohl ein paar Schnäpse zusätzlich auf die Rechnung schreiben könnte.
Autohupen auf der Landstraße! Nuni wusste, dass jetzt ihre Familie angekommen war, um sie abzuholen. Sofort sprang sie vom Tisch auf und fiel ihren Eltern in die Arme. Eine große, stattliche Figur stand etwas abseits. In der Dämmerung trafen sich ihre Augen. Diese großen, braunen, ausdrucksvollen Augen, die sie seit drei Jahren nicht mehr gesehen hatte und gleich mit Freuden erkannte.
„Bist Du es wirklich? Ich kann es kaum glauben! Ein Phänomen!“ Bobby umarmte sie, sie sah ihn nocheinmal prüfend an. Aus einem fünfzehnjährigen Jungen war ein 1,85 Meter großer Herr geworden, im grauen Anzug, mit leuchtender Krawatte!
Respektvoll küsste nun auch Daniel, der Chauffeur, Nunis Hand mit der Bemerkung, sie sehe gut aus, gar nicht so verhungert, wie man es befürchtet hatte, und schließlich stiegen alle zufrieden in den Wagen.
Czernowitz kam Nuni fremd vor. Zuhause hingegen fand sie sich sofort ein, obwohl ihr gleich aufgefallen war, dass die schönen, echten Teppiche und ein Teil der Möbel fehlten. Wie üblich, konnte sie täglich baden; „Junge gnädige Frau“, so betitelte sie Marusja, die neue ukrainische Haushälterin, „das Bad ist bereit! Und nachher schnell noch zehn Minuten ins Bett“, rief sie ihrer neuen jungen „Herrin“ zu.
Am Nachmittag empfing sie die vielen Beamten ihres Vaters, die ihr einen formalen Begrüßungsbesuch abstatteten und große Konfektschachteln mitbrachten. Die Abende verbrachte man mit langen Gesprächen.
Nuni trug dabei ihre Sorgen und Befürchtungen vor. Lilly und Silviu waren gleich mit der Rückkehr von Willy und Nuni einverstanden und schlugen ihr vor, in Czernowitz zu bleiben, bis sie auch für Willy eine rumänische Einreisegenehmigung erwirkt haben würden. Auf diesen Vorschlag mochte Nuni nicht eingehen, wollte sie doch Willy nicht in einer solch unsicheren Situation lassen, die seine Nerven mehr und mehr zermürben würden.
„Ich bleibe zehn Tage bei Euch. Falls die Genehmigung für Willy in dieser Zeit erteilt werden sollte, schicke ich sie ihm. Wenn nicht, muss ich nach Deutschland zurück, um dort gemeinsam mit ihm auf die Papiere zu warten.“
Von ihrer Ehe und ihren Problemen hatte Nuni niemandem berichtet, sonst wäre ihre Entscheidung, zurückzufahren, für ihre Lieben noch unverständlicher geworden. Nunica aber wollte Willy vor dem grausamen Krieg retten, dies war ihr einziger Wunsch.
Die Einreiseerlaubnis für Willy wurde in den zehn Tagen nicht erteilt, und als sie nach zwei Wochen nach Deutschland zurückfuhr, reichte sie am deutschen Grenzbahnhof ihrem „Chirurgen“, Leutnant Eickert, zum Dank eine Flasche Cognac aus dem Abteilfenster - und eine Pincette!
Mit dieser Episode endet dieser autobiographische Roman. Einige biographische Anmerkungen: Noch 1943 wurde Willibald Niefer die Einreiseerlaubnis nach Rumänien erteilt; Nunica und er verließen Deutschland und lebten noch etwa ein Jahr in dem (von Deutschland und Rumänien 1941 zurückeroberten) Czernowitz. Vor der erneuten sowjetrussischen Besetzung 1944 flohen Nunica und Willy samt Familien Richtung Süden in den bei Rumänien verbliebenen südlichen Teil der Bukowina (hier spielt die Episode „Meine Daunendecke“), später dann weiter nach Bukarest (hier spielen die beiden Episoden „Die Geschichte der Minna Tennenhaus“ und „Nana“). Die Ehe mit Willibald Niefer wurde 1948 geschieden. 1966 kam Genunea erstmals nach Ost-Berlin, wo sie Heinz Musculus kennenlernte - schön und plastisch erzählt in der Episode „Der Zufall - Mein Glück“. Eberhard Musculus |



