

über Menschen und Tiere werde ich
Euch erzählen, die mir als
Persönlichkeiten begegnet sind...
Genunea Musculus
Episode aus dem Roman „Genunea. Czernowitz liegt nicht nur in der Bukowina“ Cosel |








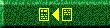
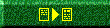
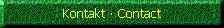
Die Wohnungsnot hatte in Cosel das gleiche tragische Ausmaß wie in Patschkau, doch fand sich im Hotel am Rathausplatz noch ein freies Zimmer. Die Hotelspesen bezahlte das Unterrichtsministerium. Nuni aber war mit dieser Situation nicht sehr zufrieden. Sie fragte sich, wie sie den lieben langen Tag verbringen konnte, ohne für ihren Willy zu kochen. So machte sie sich wieder auf die Zimmersuche und klapperte eine ganze Woche lang die Innenstadt und die vielen Seitenstraßen von morgens bis zum späten Nachmittag ab. Vor jeder geöffneten Tür aber erlitt sie das gleiche Fiasko – niemand wollte ihr und Willy eine Wohnung vermieten.
Schließlich blieb ihr nur noch die Peripherie der Stadt, und dort fand sie ihr ersehntes „Glück“. Es lag auf einer grauasphaltierten Landstraße in einem grauen, alleinstehenden Haus. Der graue, schief eingesunkene Drahtzaun markierte spärlich dieses mysteriöse Grundstück. Die Fenster des Hauses waren mit Reklameplakaten, wie „Die dicke Juno“, „Henkel-Seifenpulver“ und „Elida“ beschlagen. Unter dem Dach konnte man deutlich „Lebensmittelgeschäft“ lesen.
Ein kleiner, graugewordener Spitz empfing Nuni bellend, als sie versuchte, die hingefallene, verrostete Tür wegen ihrer empfindlichen Seidenstrümpfe besonders vorsichtig zu umgehen. Sofort erschien die Hunde- und Türbesitzerin.
„Kommen Sie doch herein, Sie möchten wohl frische Eier! Bei mir sind sie teurer, dafür aber markenfrei und von bester Qualität!“, lobte sich die Frau. Sie streckte Nuni ihre Hand entgegen und schleuderte sie samt unversehrter Seidenstrümpfe über die Wracktür in ihren Hof hinein.
Willy trottete ihr nach. „Lieb von Ihnen“, begann Nuni, „aber momentan suchen wir keine Eier, sondern ein Zimmer.“ „Ein Zimmer?“, und sie sah die beiden Eindringlinge noch interessierter an. „Das habe ich auch für Sie!“
Willy wollte gleich wieder umkehren – der grauenhafte Eindruck befremdete ihn doch sehr. Schon aber standen alle drei in dem „Zimmer“, vor der „Kanone“, dem eisernen Ofen. „Hier kann ich kochen!“, rief Nuni begeistert. Ihre Augen strahlten vor Freude, der kleine runde Ofen mit seinem großen Blechrohr zog sie derart an, dass sie den Rest des sogenannten „Zimmers“ übersah – oder übersehen wollte.
Man betrat diese Bruchbude direkt vom Hof über eine Türschwelle, der Fußboden war mit kleinen, grau-weiß-melierten Steinchen ausgelegt, die „Kanone“ – das bewusste Prachtobjekt – befand sich links von der Tür, und in der Mitte des Raumes stand ein braunabgeblätterter lackierter Tisch, dazu zwei passende braunabgeblätterte lackierte Stühle. Das breite Eisenbett mit grauen Kasernendecken erblickte man vor den mit Brettern verschlagenen Fenstern. An einer Schnur hing eine 25-Watt-Birne. Dank ihres intimen Leuchtens waren deutlich die kubistischen Muster zu erkennen, welche sich durch die strömenden Rauchwolken aus der „Kanone“ auf den einst weißen Wänden abzeichneten.
„Bitte, wo ist das Klo?“, fragte Nuni. „Nicht draußen, wie gewöhnlich; nein, wir haben eine Innentoilette, die man durch den Haupteingang von der Straße aus erreichen kann“, fügte Frau Bartsch stolz hinzu und zog aus ihrer Schürze eine Kerze hervor. Mit ihr wies sie den Weg und öffnete eine knarrende Tür, die in einen dunklen Korridor führte. „Hier haben wir keinen Stromanschluss. Seit unser Sohn im Krieg ist und das Geschäft geschlossen bleibt, sparen wir mit Elektrizität.“
Am Ende des Korridors stieg eine morsche Holztreppe ohne Geländer bis in den Dachboden. Die Kerze wurde durch die Puste der erschöpften Frau Bartsch gelöscht. Nuni stolperte über verschiedene Hindernisse, denen sie unter ihren Füßen begegnete, und fiel auf etwas Weiches. Die Kerze flammte wieder auf, und Nuni saß auf einem Strohhaufen zwischen zahllosen leeren Pappkartons. Ungeschickt stand sie auf, um das bewusste Örtchen zu finden. So leicht war dies aber gar nicht, weil sich der Dachboden über das ganze Haus erstreckte. Links bemerkte Nuni eine Tür und wollte sie sogleich öffnen, doch Frau Bartsch erklärte ihr, es sei eine Kammer, die sie auch einmal gerne im Sommer vermieten würde.
Die Suche ging weiter, alle mussten ihre Köpfe immer mehr einziehen, denn das Dach wurde schiefer und schiefer. Im Kerzenlicht war dann ein Türchen zu erkennen, oder besser gesagt, eine Bretterwand, die mit einer Schnur geöffnet werden musste. Frau Bartsch blies die Kerze aus. Sie griff die Schnur, das Brett sprang auf, und ein flatterndes Lebewesen glitt über Nunis Stirn und flog in den dunklen Dachboden hinein.
„Es ist nur eine Taube, erschrecken Sie nicht!“, beruhigte Frau Bartsch Nunica. Nun wurde auch klar, warum Frau Bartsch die Kerze gelöscht hatte: Das Klo verfügte über natürliches Licht, das von dem kleinen, schiefen, unverglasten Dachfenster direkt auf die jeweiligen Pos strahlte. „So also erreicht man die Innentoilette“, seufzte Nuni – falls man sie noch erreichte.
Die komfortable Wasserpumpe hingegen stand leicht zugänglich im Hof direkt neben Nunis zukünftigem Wohnsitz und lud direkt zu Kneipp-Kuren ein. „Die Miete für all das beträgt nur zwanzig Mark monatlich. Eier und Gemüse verkaufe ich Ihnen auch gerne“, meinte Frau Bartsch.
„Wir kommen in ungefähr drei Stunden. Hätten Sie die Freundlichkeit, das Zimmer ein wenig aufzuräumen, da hier ja lange Zeit niemand gewohnt hat“, bat Nuni ihre Vermieterin höflich.
Eine weiße Tischdecke und lustige Feldblumen, die Frau Bartsch auf den scharlachroten Tisch gelegt hatte, verwandelten das Zimmer in Optimismus. Aber aufgeräumt war es nicht. Mit der Reinigung verbrachten Nunica und Willy die halbe Nacht. Das Licht war so schwach, dass die vielen Spinnen und ihre Gewebe nur mühsam zu beseitigen waren. Hingegen stand der Eisenofen am nächsten Tag „in seiner ganzen Pracht“ zu Nunicas Verfügung. Es fiel ihr schwer, ihn in Betrieb zu nehmen, so dass Frau Bartsch ihr dabei immer helfen musste. Nuni war es nicht gewohnt, mit Spänen, Petroleum, Holzscheiten und Koks zu hantieren.
Doch auch die kleine Kochfläche auf dieser „Kanone“ bereitete ihr Komplikationen, denn zwei Töpfe zur gleichen Zeit konnte sie nicht erwärmen. Und wie bewahrt man die Kartoffeln heiß, wenn die Graupensuppe kocht, fragte sich Nuni. Auch dieses Malheur wurde von Frau Bartsch gelöst: „Die gekochten Kartoffeln werden in Zeitungspapier eingewickelt, in ein Frottéehandtuch gepackt, das Ganze dann ins Bett unter die dicke graue Decke gelegt – so warten Sie dann auf Ihren lieben Mann, bis er aus der Schule kommt.“ „Schrecklich“, meinte Nunica, „jede einzelne Kartoffel in Papier einzupacken – noch dazu Zeitungspapier, ist doch furchtbar umständlich und außerdem unhygienisch.“ „Aber nicht doch – der ganze Kochtopf wird verpackt“, murrte Nunis Hausbesitzerin.
Nach fünfundvierzig Minuten Fußweg kam Willy müde und hungrig zum Mittag nach Hause. „Es riecht ja wunderbar, aber was kracht so auf dem Boden unter meinen Füßen? Hast Du etwas zerschlagen?“ „Es ist nur der Sand, den man aus dem Hof hereinbringt. Zweimal habe ich schon ohne Erfolg aufgewischt“, klagte Nunica.
Die Kalamitäten begannen: der Sand knirschte unter den Füßen, klirrte unter den Möbeln, schmeckte in der Graupensuppe und kitzelte sie im Bett. Willy legte einen feuchten Lappen vor die Türschwelle, um das Übel an den Füßen gründlich abstreifen zu können. Dabei entstand der perfekte Charleston-Tanz, wenn sie in die Stube traten. Doch nichts half – der Sand befand sich ständig auf dem steinernen Boden und entwickelte vielfältige Klänge, die von der Qualität der Schuhsohlen abhingen. Holzlatschen zum Beispiel brachten grelle und schrille Dissonanzen barbarischer Musik hervor, Gummisohlen hingegen klangen lieblicher, jedoch pessimistisch.
Da Ledersohlen nur für Soldaten auf Bezugsscheinen zu erhalten waren, konnten sie deren Musikalität nicht feststellen. Nuni und Willy wurden immer verzweifelter, ihr Sand-Syndrom verfolgte die beiden wie eine Fata Morgana, denn fast alle Organe litten darunter, die Zunge, die Nasenlöcher, die Kopfhaut, die Speiseröhre, die Augen etc. etc.
Sie spuckten, niesten, husteten, kratzten sich und blinzelten mit den Augen. Es kam soweit, dass sich diese nervösen Ticks nicht nur in ihrer „Prachtwohnung“, sondern auch auf der Straße zeigten, bei Freunden, und, was noch peinlicher war, bei Kino-, Theater- und Konzertbesuchen. Eines Tages endlich bat Willy mehrere deutsche Experten seiner Schule, dieses Geräuschphänomen zu überprüfen und zu erklären. Alle kamen sie, um zu helfen. Der Musiklehrer war besonders interessiert, da die entstandenen Sandsohlentöne und -tonarten ihn zu aphoner, zeitgenössischer, „entarteter“ Musik inspirierten. Auch Mathematiker und Physiker traten mit Kenneraugen in die laute Stube ein und fanden sogleich die Ursache heraus: Der Sand drang durch die porösen Wände, durch Tür- und Fensterritzen erbarmungslos ein; dagegen könne man nichts tun, als das Haus abzureißen.
So verließen die beiden Sandbestreuten, Nuni und Willy, mit Wehmut, ohne Ziel und Hoffnung, die grauasphaltierte Landstraße mit dem grauen, alleinstehenden Haus, dem grauen, eingesunkenen Drahtzaun, dem graugewordenen Spitz und dem ergrauten Leben der Frau Bartsch.
Erst nach weiteren acht Wochen Hotel-Leben fanden Nuni und Willy einen menschenwürdigeren braunlackierten Holzfußboden unten ihren Beinen; dieser lag am anderen Ende der Stadt bei einer Frau Modler und war mit einem weichen Teppich ausgelegt. Um diesen zu ereichen, musste man drei Stufen in das Souterrain hinuntersteigen. Außer dem Fußboden besaß das Zimmer zwei Betten, ein Canapée, Tisch, Waschtisch, einen Kachelofen und einen penetranten, feuchten Schimmelgeruch. Frau Modler entschuldigte diesen mit der Begründung, sie habe nicht jeden Tag lüften können. Da die Fenster nur in Form kleiner Oberlichter existierten, konnte man sie nur mit Hilfe eines Stuhls oder einer Leiter erreichen.
„Sie werden sich schon daran gewöhnen“, meinte Frau Modler. „An was gewöhnen? An das Heraufkraxeln oder an den Geruch?“, fügte Nuni hinzu. In der Küche stand ein großer eiserner Herd mit Backofen und „allen Schikanen“.
„Ich gestatte Ihnen, hier zu kochen. Platz für uns beide ist ja reichlich da.“ Frau Modler fuhr fort. „Es ist nur eine Notlösung für mich, diese improvisierte Wohnung. Seit ich meinen Mann verlor, habe ich unsere Dreizimmerwohnung in der Stadt aufgegeben und mich hierher zurückgezogen. Dieser Bau diente vor dem Krieg als Stall und gehörte zum zweistöckigen Haus von nebenan. Im anderen Zimmer habe ich eine Kaninchenzucht – und jeden Sonntag guten Braten.“ Die Kaninchen als Nachbarn zu haben, schien Nunica wunderbar, aber sonntags sie zu verzehren, unmenschlich...
„Am liebsten würde ich doch wieder ins Hotel ziehen“, meinte Willy. „Wenn ich nicht wüsste, aus was für einem Haus Du stammst, könnte ich denken, dass Du nie den geringsten Komfort kennengelernt hast.“
„Verzeih bitte, aber ich habe Dich lieb und möchte für Dich auch etwas tun. Im Hotel gibt es dazu keine Gelegenheit, und mein Essen schmeckt Dir doch viel besser als das in der Gaststätte. Darauf bin ich stolz und das macht mich glücklich“, entgegnete Nunica.
Für Willy begann eine schwere Zeit. In seiner Oberschule lehrte man weder Latein noch griechisch, und so beauftragte man ihn, Deutsch, Geschichte und Turnen zu unterrichten, obwohl er diese Fächer nie studiert hatte. Nunica half ihm jeden Nachmittag bei den schwierigen Vorbereitungen. Er bekam Fachbücher, und beide „büffelten“ nun wie richtige Schüler.
Dann prüften sie ihre Kenntnisse, und es entstand ein regelrechter Wettbewerb zwischen ihnen. Von deutscher Geschichte hatte Nuni nur wenig Ahnung. Es amüsierten sie aber die vielen Fürsten und Herzöge aus den früheren 365 Kleinstaaten, die sie auf diese Weise kennenlernte. Sie gingen auch zweimal wöchentlich ins Kino, und der Sonntag war für Besuche reserviert. Ziemlich rasch fanden sie Freunde unter den Lehrern und fühlten sich wohl.
Von noch größerer Bedeutung aber war die Annäherung an die Eltern der Schüler, die ein Lebensmittelgeschäft, eine Bäckerei oder Fleischerei besaßen. Dort bekam Nuni unter dem Ladentisch neben der Normzuteilung fast immer markenfreien Nachschub.
So spürte sie die Lebensmittelnot nicht so sehr, und die Kochtöpfe befanden sich im vollen Einsatz. Woran sich Nuni aber nicht gewöhnte, waren die halben, schwer erreichbaren Fenster – nicht nur wegen ihrer komplizierten Handhabung, sondern es störte sie auch die neue Perspektive: Die vorbeilaufenden Menschen waren halbiert! Nuni bekam sie nur vom Nabel abwärts zu Gesicht. Kleine halbe Bäuche, große halbe Bäuche, halbe werdende Mütter oder Spreizbeine, halbe Herrenhosen, halbe Damenfaltenröcke, ganze schwarze Schuhe, Einkaufstaschen, Kartoffelnetze, Regenschirme, ganze oder dreiviertelgroße Kinder, aber ganze Hunde und ganze Katzen!
Etwas Peinliches erlebte Nuni eines Tages, als sie vom Einkaufen nach Hause zurückkehrte. Sie befand sich vor dem großen zweistöckigen Haus, als ihr eine Dame entgegentrat und sie auf folgende Art und Weise ansprach: „Hören Sie mal. Sie wohnen nun schon drei Wochen hier, sind Rumänin und grüßen mich nicht. Sie wissen wohl gar nicht, wer vor Ihnen steht. Ich bin sechsunddreißig Jahre alt, habe dem Führer sechs Kinder geschenkt und mein Achtzehnjähriger hatte schon das Glück, für ihn auf dem Feld der Ehre zu fallen. Und Sie junges Ding grüßen mich nicht, haben keine Kinder, und wie ich merke, auch nicht die Absicht, welche in die Welt zu setzen. Täglich spazieren Sie nur mit Ihrem Mann herum.“
„Verzeihung, gnädige Frau...“, und schon wurde die eingeschüchterte Nuni unterbrochen. „Es gibt im Dritten Reich keine ‚gnädige Frau‘. Mein Name ist Freick. Mein Mann ist unabkömmlich, weil er einen hohen Posten bekleidet. Er ist Oberbezugsscheininspektor im Rathaus. Das wollte ich Ihnen noch mitteilen. Und wir wohnen hier in diesem feinen Haus, wo nur bessere Leute wohnen dürfen.“ Ihr schmales Gesicht wurde durch das aufgestiegene Blut breiter und ihre kleinen braunen, ungekämmten Löckchen, die Nuni an rumänische Kohlrouladen erinnerten, bewegten sich nach jedem geschrienen Wort wellenmäßig auf ihrem Kopf.
Dann ließ Nuni ihre Blicke auf die Unterpartie der Frau Ober-Bezugsscheininspektorin gleiten, um sie aus ihrem Oberlichtfenster identifizieren zu können. „Es tut mir aber so leid, dass Sie auf mich böse sind. Ich hätte da aber eine Frage an Sie: Ist Ihr Mann Ober-Unterwäsche-Bezugsscheininspektor oder Ober-Bettwäsche-Bezugsscheininspektor“, fragte Nuni, da ihr Bestand an Damenschlüpfern kläglich aussah. „Gehen Sie mal selbst ins Rathaus. Sein Name ist überall angeschlagen, und Sie werden Auskunft erhalten.“
Mit diesen Worten verabschiedete sich Frau Freick, verschwand im ihrem hochherrschaftlichen Haus und ließ die Umsiedlerin unaufgeklärt stehen. Von nun an grüßte Nuni in neuem Fliederlila oder in himmelblauen Schlüpferchen, die sie von Herrn Freick mit seinen Bezugsscheinen erhalten hatte, alle Fußgänger, denen sie auf der Straße begegnete.



