

über Menschen und Tiere werde ich
Euch erzählen, die mir als
Persönlichkeiten begegnet sind...
Genunea Musculus
Episode aus dem Roman „Genunea. Czernowitz liegt nicht nur in der Bukowina“ Übergangslager Wartha |








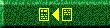
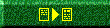
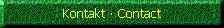
Nach zwei Tagen verließ man Laurahütte und wurde in ein großes Lager nach Wartha gebracht, ein ehemaliges Nonnenkloster. Hier begannen Nunis Flitterwochen. Auf einer kleinen Anhöhe gelegen, war das Kloster von zwölf Kapellen mit Plastiken biblischer Motive umgeben. Unten im Tal lag das kleine schlesische Dorf Wartha, berühmt durch seine Pfefferkuchenfabrik.
In dieser Umgebung sollten 1200 Umsiedler mehrere Monate verbleiben, sich an die neue Heimat gewöhnen und sich verschiedenen Experimenten ergebenst unterziehen, die die neue Lebensweise, das Essen und vieles mehr betrafen. Wie üblich, begrüßte sie auch hier der Lagerführer mit warmherzigen Worten und versicherte ihnen eine baldige strahlende Zukunft. Dann wies man den Glücklichen ihre Wohnung zu.
Voller Neugierde stiegen Nuni und Willy die Treppen hinauf zur dritten Etage und fanden im Zimmer Nr. 356 ihre Herberge. Die Tür ließ sich nur einen Spalt breit öffnen, da die Betten sie fast völlig verbarrikadierten. Ein schräges, kleines Fenster, hoch oben unter der Decke, ließ das Tageslicht nur sehr spärlich eindringen. Nuni hatte den Eindruck, als ob Nebel im Raum lag. Erst nach einigen Minuten hatte sich das Auge daran gewöhnt, die graue Wolke schien sich etwas zu lichten. Sie stand mitten im Zimmer, von vielen grauen Eisenbetten mit grauen Schlafdecken umringt. Dann schaute sie hinauf, um vor Schreck Luft zu holen. Doch die Decken verschwanden aus ihrem Blickwinkel nicht. Überall... unten, oben... graubedeckte Betten!! Prüfend studierte sie die für sie so neue Bettenkonstruktion, Doppelbetten, die sie zum ersten Mal in ihrem Leben sah.
Willy bemerkte ihre Unruhe und zeigte auf die beiden unteren Betten, die sich neben der Tür befanden. „Hier werden wir schlafen. Du bist sicher zu ängstlich, um auf das obere Etagenbett zu steigen“, sagte er ihr leise. „Wahrscheinlich musste man diese komischen Betten wegen des zu geringen Lebensraumes bauen“, meinte Nuni ironisch, nachdem sie wieder zu sich gekommen war. Im Zimmer waren vier Etagenbetten untergebracht, und um den „Lebensraum“ noch besser auszufüllen, hatte man unter das Fenster noch ein zusätzliches Parterrebett gestellt. Drei ebenso junge Ehepaare ließen sich auf den unteren und oberen Betten nieder.
Die Atmosphäre lockerte sich, man begann, Späße zu machen und froh zu sein, dass alle Zimmerbewohner fast gleichaltrig waren. Eine Frage aber blieb offen. Von wem und wann würde das neunte Bett unter dem Fenster belegt werden? Hinter der Tür fand man erstaunlicherweise noch einen freien Platz für die Ablage der Koffer. Gegenüber, am Flur, befand sich der Waschraum und die Toiletten. Herr J. wurde einstimmig zum „Zimmerältesten“ gewählt. Er musste die tägliche Arbeitseinteilung seiner mitschlafenden Frauen und Männer nach Listen, nach vielen Listen organisieren. Seine Zuständigkeit erstreckte sich auf das Wecken und Schlafengehen seiner „Compagnie“. Gefrühstückt wurde um acht Uhr morgens in den zwei großen Parterre-Sälen, in denen man auf langen Holzbänken den „Caro-Kaffee“ und zwei Marmeladenbrote vorfand.
Dann wurde man zur Arbeit gebeten. Die Aktivitäten der Frauen variierten auf einer breiten Skala von Kartoffelschälen bis zur Toilettensäuberung, die der Männer vom Abholen der Lebensmittel bis zur Straßenreinigung. Einen freien Tag in der Woche gab es, außer dem Sonntag, für alle Lagerinsassen auch. Kritischer wurde die Situation mittags, wenn die 1200 Menschen um elf Uhr im langen Korridor schlangestehen mussten. Jeder bekam eine Blechschüssel gereicht und wartete, bis „Kameradin“ Frieda, die Küchenchefin, die Graupensuppe zuteilte. Diese Fütterungsprozedur dauerte mehr als eine Stunde. Abendbrot wurde genau wie das Frühstück serviert, mit dem einen Unterschied, dass man anstelle von „Caro-Kaffee“ Pfefferminztee bekam und die beiden Marmeladenbrote durch Käsebrote ersetzt waren.
Das feierliche Sonntagsessen bestand immer aus Gulasch mit Kartoffeln und Kürbis- oder Rhabarberkompott zum Nachtisch. Diese monotone Kostsinfonie beunruhigte Nunis Magen nicht im geringsten. Die tägliche dicke Graupensuppe, die Nunica auch erst hier kennengelernt hatte, schmeckte ihr vortrefflich, doch es fehlten ihr auch altgewohnte lukullische Süßigkeiten.
Nur wenige Mark bekam man als Taschengeld; sie reichten aber aus, um ihren Naschzwang zu lindern. Als sie mit Willy das Dorf besuchte, entdeckte sie mit Entzücken die Pfefferkuchenfabrik. Leider wurden diese Köstlichkeiten nur gegen „Kuchenmarken“ verkauft, die Nuni nicht besaß. Doch ihre gierigen Blicke beim Betrachten der Backwaren versetzte die Inhaberin in Mitleidsgefühle, und diskret packte sie unter dem Ladentisch täglich zwei oder drei Pfefferkuchensterne für ihre Umsiedlerin ein.
Das graue Betten- und Deckenensemble hingegen verursachte Nuni einen grauenhaften depressiven Komplex, der sich tragisch-komisch auswirkte. Sie bekam immer Lachkrämpfe, wenn Willy sie z.B. zu küssen versuchte. Der Arme musste darum nolens-volens Abstinenzler werden, und Nunica wartete darum sehnsüchtig auf ihr eigenes Heim, wenigstens auf ihre eigenen vier Wände, wo die Küsse nicht belauscht würden.
Tage und Wochen vergingen. Man gewöhnte sich an das Warten auf die Graupensuppe, das Warten auf die Einbürgerungskommission und das Warten auf „den Sieg“.
Beim Verrichten ihrer Arbeiten war Nuni nicht sonderlich geschickt. Die Kartoffelschälerei fügten ihr außer technischen Schwierigkeiten auch gesundheitliche Schäden zu. Zweimal wöchentlich musste sie fünf bis sechs Stunden in einem Keller auf einem Hocker oder Marmeladeneimer sitzen, zusammen mit ungefähr zwanzig weiteren Frauen, und Unmengen von Kartoffeln sehr, sehr dünn abschälen. Die Blicke erfahrener Hausfrauen bemerkten mit Entsetzen Nunis etwas „zu dick“ geschälte Kartoffeln. „Passen Sie doch auf. Sie tun ja so, als ob Sie noch nie Kartoffeln geschält hätten!“, ertönten die empörten Weiberstimmen. „Ich kann es noch nicht so gut wie Sie, meine Damen, ich möchte es aber gerne lernen. Nächste Woche gelingt es mir sicher schon besser“, erwiderte Nuni mit zittriger Stimme. „Also haben Sie doch noch nicht zuhause Kartoffeln geschält. Sie hatten wohl eine Köchin. Sie sind wohl etwas Besseres. Hier kann man Sie aber nicht verwöhnen, hier müssen alle ran, ran für den Führer, ran für den Sieg!“, meinten die „Guten“ weiter. Ab und zu kam auch „Kameradin“ Frieda, um die Arbeit zu kontrollieren. Bei ihr versuchten die umgesiedelten Frauen sich einzuschmeicheln, indem sie Nuni immer mehr diskreditierten. Ob ihr aber in den folgenden Wochen die Schälerei besser gelungen wäre, ist die Frage.
Tatsache war, dass sie sich durch die Feuchtigkeit im Keller einen Blasenkatarrh zulegte, der sie noch viele Jahre, bis zum Erscheinen der Sulfonamide, plagen sollte. Für zwei Wochen wurde Nuni vom Lagerarzt von dieser Tätigkeit befreit. So blieben ihr die anderen Arbeiten übrig – Zimmerräumen, Fensterputzen, Küche wischen, Toiletten reinigen...
Die Nachricht aber über Nunis Vorleben und ihrer Abstammung wurde von einigen, die sie aus Czernowitz kannten, schlagartig im ganzen Lager ausposaunt. Dadurch wurde Nuni von vielen schief angesehen und boykottiert. Sie litt darunter und bat die Frauen, Geduld zu haben mit ihr – es sei schließlich noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Alles wollte Nuni mit Geduld lernen, doch fand sie bei ihren „Kameradinnen“ keinerlei Verständnis. Ihre Gutmütigkeit und Willenslust wurde von den perfekten „Reibefrauen“ ironisiert und ignoriert. Willy nahm seine Frau stets in Schutz, aber auch das bewirkte nicht mehr als Unruhe.
Eines Tages aber stellte sich Frau Glaser als neuntes Mitglied der Zimmergemeinschaft Nr. 356 vor und belegte das verlassene Bett unter dem Fenster. Sie hatte zwei Jahre zuvor ihren Mann verloren, der als Bäckermeister gearbeitet und ihr ein schönes Leben geboten hatte. Jetzt war sie im besten Alter von 43 Jahren alleingeblieben und unter dem schiefen Fensterbrett gelandet. So kamen ihr die Tränen, als sie ihre Geschichte erzählte. Mit Verständnis wurde sie aufgenommen.
Nach ein paar Nächten jedoch traten für Frau Glaser „sonore Schwierigkeiten“ auf oder, wie man heute sagen würde, „umweltstörende Geräusche“. Um 22.00 Uhr mussten alle Umsiedler programmgemäß im „Bette“ sein, doch das Flitterwochenzimmer Nr. 356 ließ sich vom Erscheinen der Frau Glaser nicht in ihren erotischen Empfindungen hemmen, was die arme Alleingebliebene anscheinend als sehr unartig empfand. Erst begann sie zu husten, und als ihr klar wurde, dass man darauf nicht reagierte, lief sie auf den Korridor und wartete vor der Zimmertür. Im Abstand von fünf bis zehn Minuten öffnete sie langsam und lauschte, ob noch Töne von den Betten erklangen. Die jungen Leute begannen dann erst recht, die Strohmatratzen zu strapazieren, um Frau Glaser noch eine Weile vor der Zimmertür warten zu lassen. Dieses Spiel und Zwischenspiel konnte das Nervensystem der verwitweten Frau Glaser nicht lange aushalten. Schon am nächsten Tag lief sie zu ihrem Lagerführer, um sich über die „Unverschämtheit“ der jungen Menschen zu beschweren. „Was denken Sie sich eigentlich, Frau Glaser?“, meinte der Lagerleiter erstaunt, „Deutschland braucht Soldaten für seinen Führer. Ich kann doch nicht die jungen Paare hemmen.“
„Dann geben Sie mir bitte ein anderes Zimmer.“ Leider mussten sich ihre Ohren für lange Zeit an diese Geräusche gewöhnen, da es im Lager kein anderes freies Bett gab.



